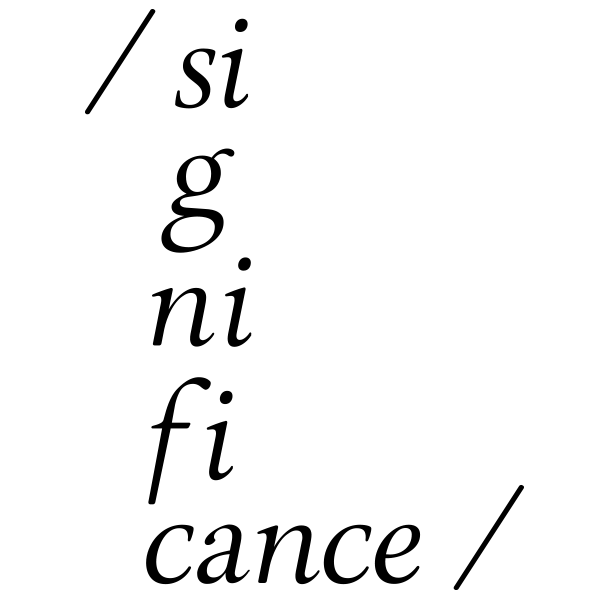„Na, die Damen – heute ganz allein hier?“, sagt der Kellner in der Taverne, als er uns größerer Gruppe Frauen die Speisekarten überreicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf diese Dummheit zu reagieren. Man kann das Disputieren beginnen. Oder den Mann nach mehr Ouzo laufen lassen, denn wer in den 1950-ern hängen geblieben ist, wird auch in einer Grundsatzdiskussion nicht einsehen, dass zehn Frauen ohne Mann vieles sind, aber ganz bestimmt nicht allein.
Man kann in seiner Sprache man durch frau ersetzen. Oder stets man/frau schreiben, um der Parität genüge zu leisten, oder sagen wir, jener Parität, die vor LBGT galt. Seit das Bundesverfassungsgericht die dritte Eintragung anerkannt hat, schreibt man/frau besser man/frau/x. Entschuldigung, schreibt man/frau/*x. Autor*ixe, die nach Zeilen gezahlt werden, sollten sich für diese Variante entscheiden. Allen anderen empfehle ich das generische Maskulinum, denn die Bedeutung eines Worts entscheidet sich nicht im Wort, sondern an einer Vielzahl von Kriterien: wo wer wie spricht und wo wer wie empfängt – und die Poststrukturalisten unter uns wissen, dass diese Kriterien prinzipiell endlos sind, Sprache also immer ein Wagnis ist. Schön wär’s ja, wenn ein Wort eine festgelegte Bedeutung hätte, die alle immer gleich verstehen, aber denken wir allein an das Wort geil und wie begeistert unsere Eltern damals waren, als wir es nach Hause brachten, dann weiß man schon: Bedeutung hängt eben unter anderem vom Soziotop ab, in dem man gerade schwimmt. Ich unterstütze jedes Bemühen, das gleichberechtigte Soziotop in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu installieren, aber mein Wissen über und meine Erfahrung mit Sprache sagen: ein Gendersternchen macht noch keine Gleichberechtigung und sie treibt sie auch nicht wirklich voran.